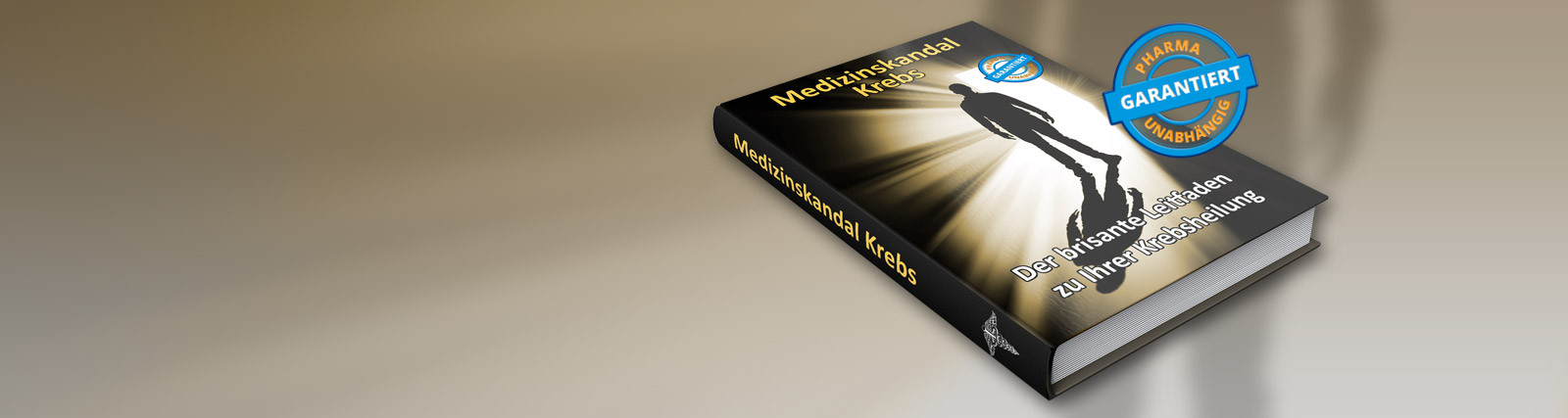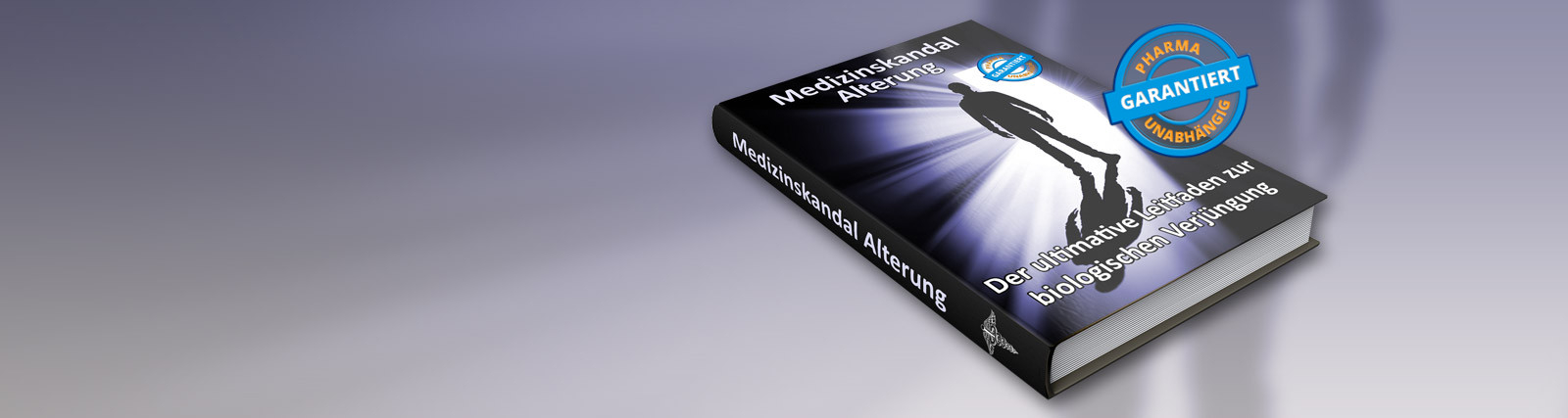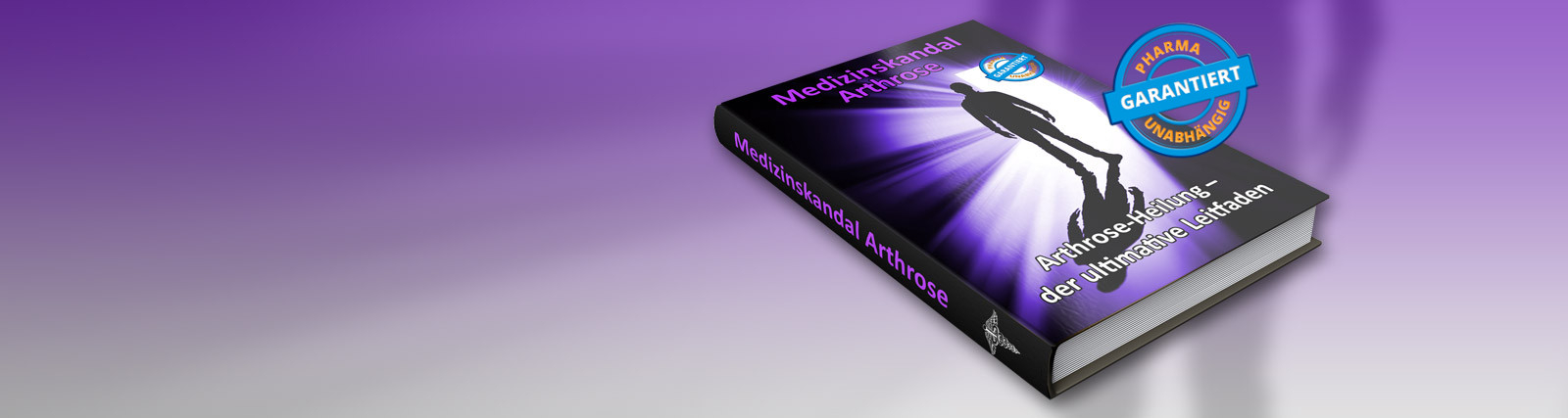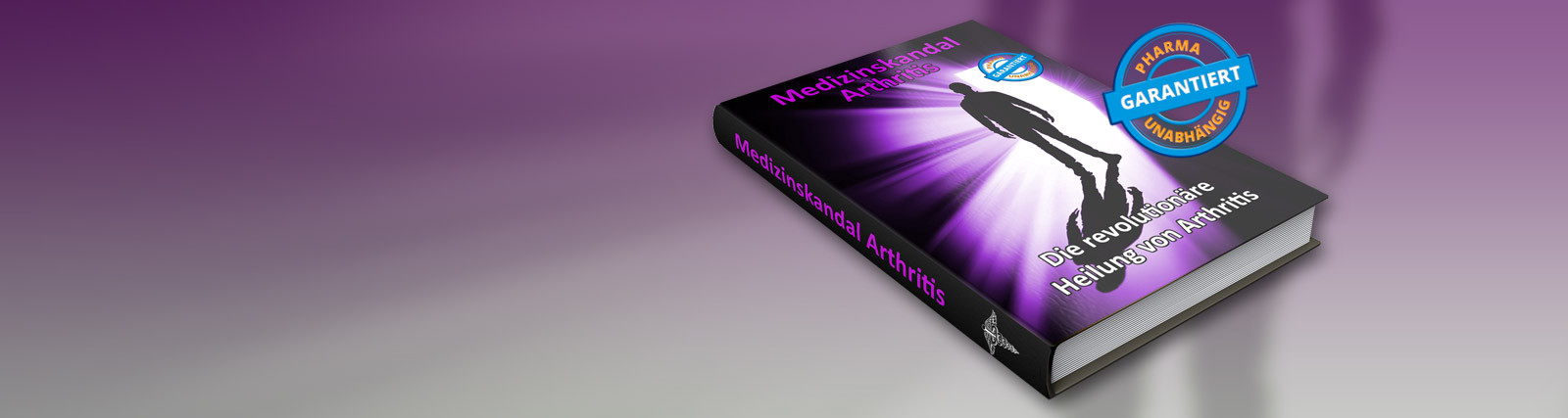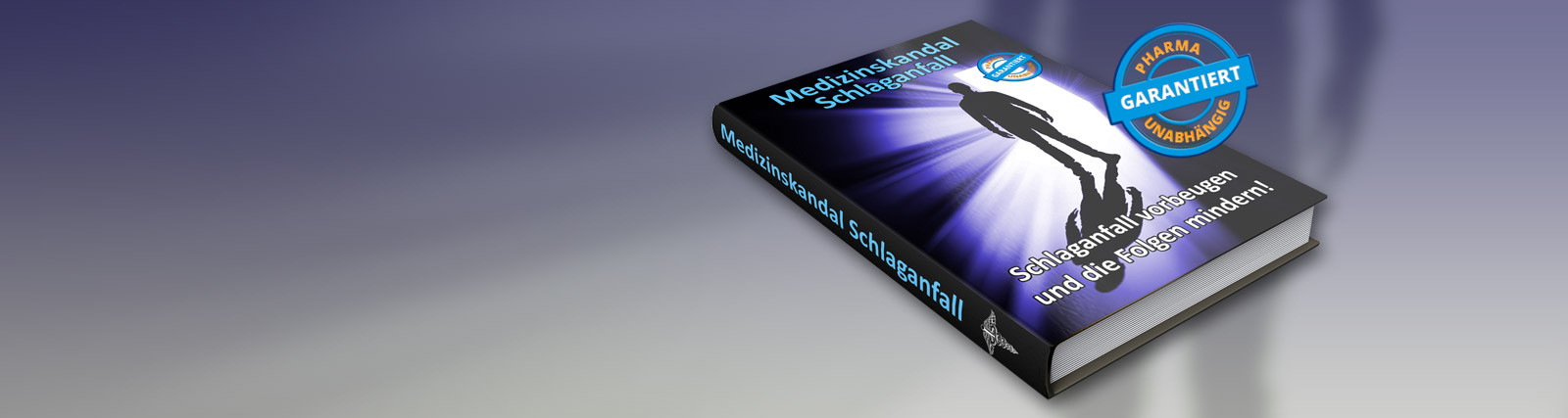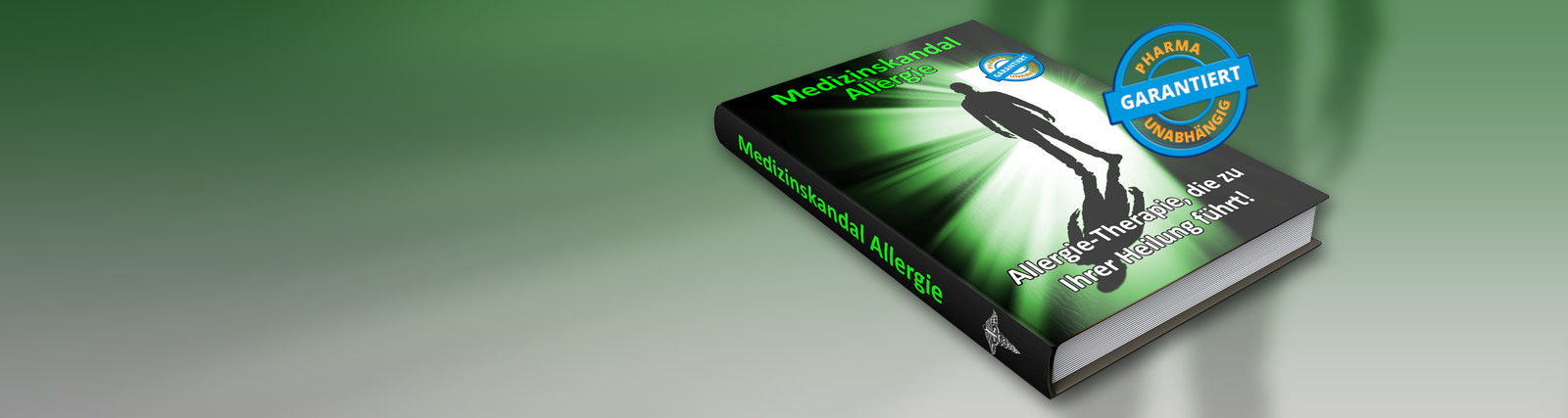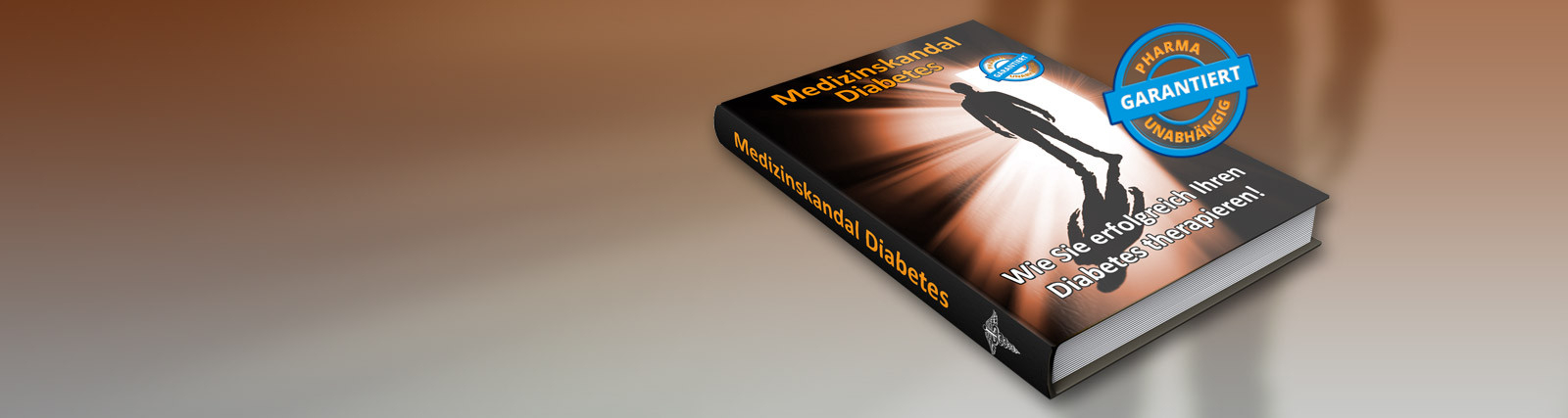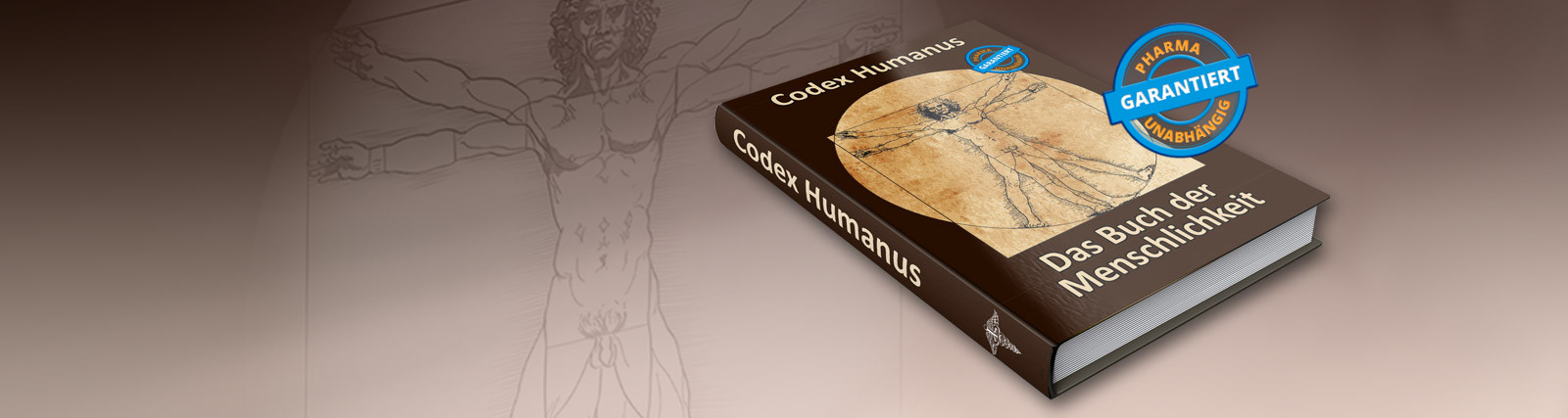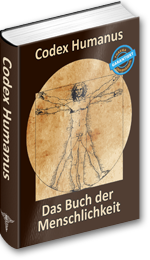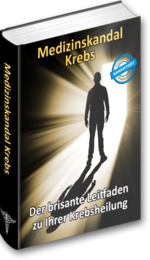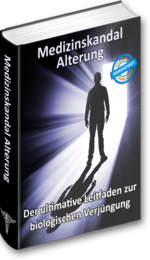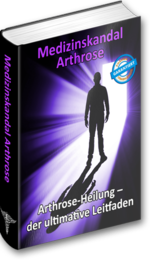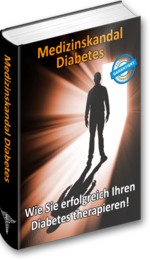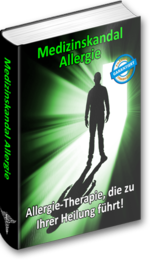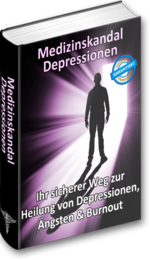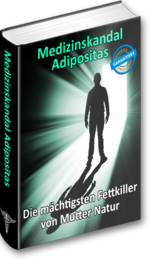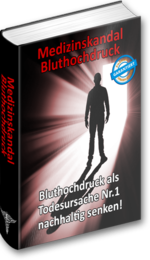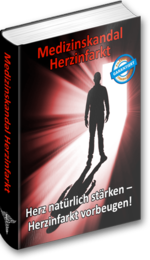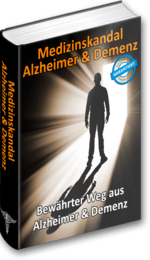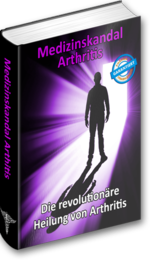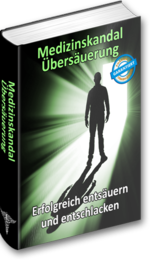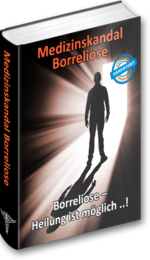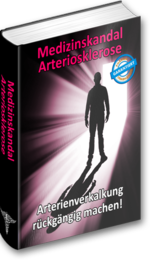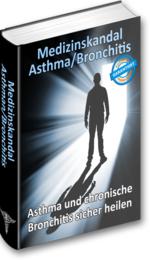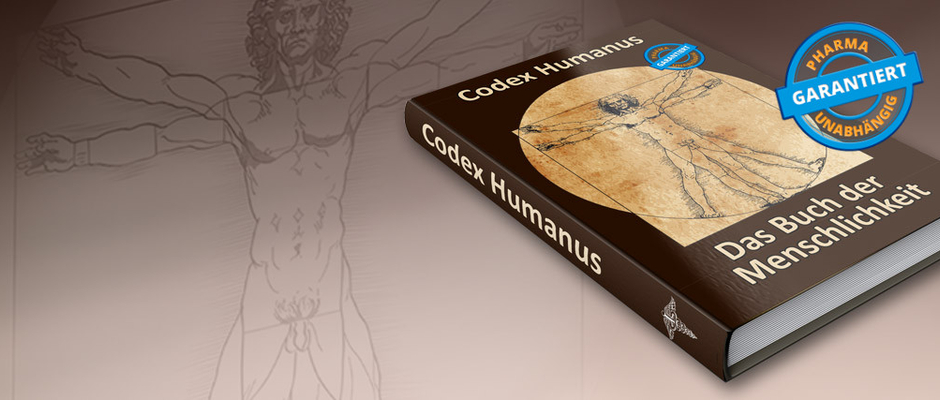L-Arginin – eine bemerkenswerte Aminosäure
L-Arginin bewirkt im Körper die Freisetzung von Wachstumshormonen und wirkt dadurch dem Altern entgegen, ebenso schützt es die Blutgefäße, stärkt das Immunsystem, kräftigt das Haar, sorgt für schöne Haut, fördert die Wundheilung und sogar für mehr Potenz. Das war aber noch nicht alles, was diese erstaunliche Aminosäure so besonders macht. Doch was genau ist an dieser Aminosäure so wertvoll für den Organismus?
Was ist L-Arginin?
L-Arginin ist eine semi-essentielle Aminosäure, welche an einer Vielzahl von Prozessen im Körper beteiligt ist und so einen besonderen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden hat. Unter anderem ist es involviert an der Produktion von Stickstoffmonoxid (NO) – bzw. Arginin ist dessen Vorstufe.
Stickstoffmonoxid wiederum ist ein Molekül, welches bei der vaskulären Regulation (gesunde Funktion der Blutgefäße), Immunaktivität sowie den endokrinen Funktionen eine entscheidende Rolle spielt. Zudem ist L-Arginin an der Protein-Produktion, Wundheilung, erektilen Funktion und Fertilität beteiligt.
Obwohl L-Arginin selbst vom Körper synthetisiert werden kann (aus Glutamin, Glutamat und Prolin) und demzufolge als „nicht-essentielle“ Aminosäure kategorisiert wurde, wird der Plasma-Argininspiegel allerdings hauptsächlich über die Nahrungsaufnahme beeinflusst. Dies hat den Hintergrund, dass die Geschwindigkeit, mit der der Körper L-Arginin selbst synthetisieren kann, durch die Arginin-Biosynthese, nicht ausreicht um eine mangelhafte Versorgung mit L-Arginin oder eine Abnahme des Plasma-Argininspiegels zu kompensieren.1
Hinzu kommt nicht selten ein gesteigerter Bedarf dieser bedeutungsvollen Aminosäure aufgrund von Stress, Sport oder Erkrankungen. Für eine optimale Versorgung des Körpers ist daher eine Zufuhr in Form von argininhaltigen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll beziehungsweise notwendig. Dementsprechend wird nicht selten die Meinung unter Experten vertreten, dass L-Arginin für den Körper mittlerweile als „essentiell“ betrachtet werden müsste.
L-Arginin – Wirkmechanismen im Körper und Einsatzgebiete
Aufgrund der vielseitigen Auswirkungen von L-Arginin auf den Stoffwechsel, kann es, wenn es im Körper in gesunder Menge vorhanden ist, zahlreiche Körperfunktionen positiv beeinflussen. Bisher wurden positive Auswirkungen beispielsweise bei Enzymproduktion, Hormonhaushalt sowie als Baustein der Proteine (proteinaufbauend) nachgewiesen. Dies hilft unter anderem beim Muskelaufbau aber durch die Proteinaufbauende Wirkung ist Arginin ebenfalls an der Kollagenbildung beteiligt und sorgt hiermit zum Beispiel für ein volleres Haar. Des Weiteren verfügt Kollagen über eine hohe Fähigkeit Wasser zu speichern und kann so von innen heraus die Haut aufpolstern, glätten und festigen.2 Darüber hinaus beeinflusst Arginin den Hormonhaushalt und die Freisetzung von Wachstumshormonen, Insulin, Glucagon und Prolactin. Ebenso ist es Bestandteil des Hormons Vasopressin (Hormon des Hypophysenhinterlappens).
Weiterhin ist Arginin die Vorstufe von wichtigen biochemischen Substanzen. Es wird insbesondere für die Herstellung von Sauerstoffmonoxid (NO), Prolin, Polyamine, Creatine, Glutamat, Harnstoff und Agmantin vom Körper verwendet. Aufgrund dieser Fähigkeiten wirkt es stärkend auf das Immunsystem, stimuliert die Tyhmusdrüse und fördert die Produktion von Lymphozyten. Es wirkt zum Beispiel auch prophylaktisch sowie kurativ bei Ulzera (Geschwüren). Darüber hinaus fördert es bei Männern die sexuelle Leistungsfähigkeit.3

"Wie Sie erfolgreich Ihren Diabetes therapieren!"
Wie Sie mit geheim gehaltene Studien und dem Insiderwissen der besten Diabetes-Therapeuten der Welt erfolgreich Ihren Diabetes therapieren und sich vor unangenehmen Folgen von Diabetes schützen!
*1 o.V. (2005): L-Arginine Monograph. Thorne Research, Inc. (Hrsg.). In: Alternative Medicine Review. Volume 10, Number 2. 2005. Abgerufen auf: www.anaturalhealingcenter.com
*2 o.V. Kollagen. Abgerufen auf www.elasten.de
*3 M.Z. Gad, Anti-Aging effects of L-arginine. Journal of Advanced Research. Volume 1, Issue 3, July 2010, Pages 169–177